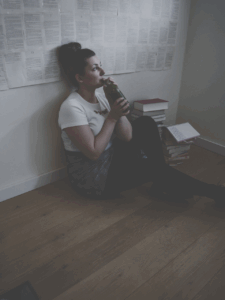Du hast eine einzigartige Buchidee im Kopf, die sich dir nahezu aufdrängt? Dir juckt es in den Fingern und eigentlich willst du dich nur an den Schreibtisch setzen und loslegen?
Dann warte noch eine Minute und atme kurz durch, denn die folgenden fünf Fragen solltest du unbedingt beantworten können, bevor du das erste Wort tippst.
1. Welchen Zeitrahmen wird mein Roman umfassen?
Das ist eine Frage, die ich mir im Schreibprozess meines Debüts viel zu spät gestellt habe – aus mehreren Gründen. Einerseits ist die Frage nach dem zeitlichen Rahmen eines Buches nicht gerade offensichtlich, weil auf 800 Seiten sowohl die Geschichten dreier Generationen, als auch ein halber Tag beschrieben werden können. Im besten Fall werden Zeitsprünge so subtil eingebaut, dass die Leserin zwar darauf aufmerksam wird, sie aber nicht hinterfragt oder gar als störend empfindet.
Andererseits wird der zeitliche Rahmen einer Geschichte, sei es nun in einem Film, einer Serie oder eben in einem Buch, bei Besprechungen nur sehr selten thematisiert. Ich jedenfalls bin noch nie aus dem Kino gekommen und habe mir gedacht: Mei, das war aber eine ganz schön turbulente Woche für die Protagonistin.
Für das reine Genießen von Geschichten ist es nicht bedeutsam, welcher Zeitrahmen abgedeckt wird. Ein paar wenige Minuten Handlung, die zwischen zwei Buchdeckel gepresst werden, können genauso mitreißend sein wie eine Jahrzehnte umfassende Erzählung.
Anders verhält es sich jedoch, wenn man selbst zur Köchin einer Geschichte wird. Dann ist die Zeit eine essentielle Zutat, vor allem, weil sich mit ihr so wunderbar spielen lässt.
Zeit kann ich Büchern gedehnt werden bis eine einzige Sekunde mehrere Seiten umfasst. Sie kann aber auch übersprungen werden, gänzlich ignoriert. Du entscheidest, wann der richtige Punkt ist, um in die Szene einzusteigen. Du entscheidest, wie dicht, wie schnell oder langsam deine Erzählung wird.
Außerdem kannst du deine Leserinnen in die Vergangenheit entführen, indem du Rückblenden an der passenden Stelle einbaust. Du kannst dein Projekt auch direkt auf verschiedenen Zeitebenen spielen lassen. Ich persönlich bin ein großer Fan von Romanen, die auf mehreren Zeitebenen spielen. Ein gutes Beispiel dafür ist „Es“ von Stephen King.
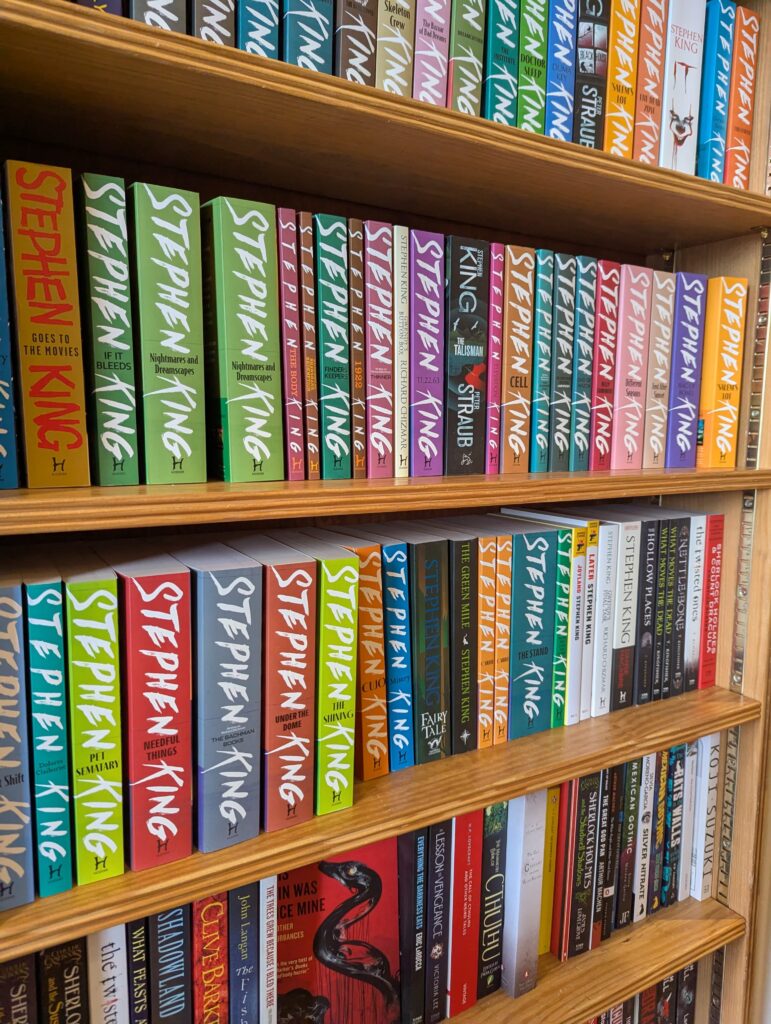
2. Wo wird mein Roman spielen?
Nach dem „Wie lange?“ ist die nächste Frage, die du dir unbedingt vor dem Schreiben stellen musst, das „Wo?“.
Auch hier gibt es eine ganze Bandbreite von Antworten. Manche Autorinnen schreiben grundsätzlich nur über ihre Heimatstadt oder ihr Heimatland, andere wählen populäre Orte wie die USA oder Schottland. Häufig ergibt sich das Setting eines Buches auch automatisch aus der Buchidee. Wenn ich über eine Akademie für die Kinder von Vampiren schreiben will, werde ich diese Schule vermutlich nicht nach Ibiza verfrachten.
Nicht selten ist das Setting auch essentieller Bestandteil des Buches. Manche Geschichten leben geradezu von ihrem ausgeklügelten Worldbuildung, man denke nur mal an Tolkien oder George R. R. Martin.
Jedoch spielt Worldbuilding nicht nur in epischer Fantasy eine Rolle, sondern in jedem Roman. Frage dich, ob du reale Handlungsorte für deine Geschichte zweckentfremden willst oder ob du dir das Setting ausdenken möchtest. Beides bringt Vor- und Nachteile mit sich:
Fällt deine Wahl auf reale Orte, so musst du dir darüber im Klaren sein, dass es auffallen wird, wenn du den Ort selbst nicht kennst. Manche Leserinnen werden sogar so weit gehen und die im Buch beschriebenen Wege gehen. Ein Großteil meines zweiten, noch unveröffentlichten Romans spielt in Prag und ich habe bereits zwei Recherchereisen dorthin unternommen. Es hat etwas geradezu Magisches, frühmorgens dieselben Straßen entlangzuschlendern wie die eigenen Figuren, so viel kann ich versprechen.
Ich persönlich habe mich übrigens dagegen entschieden, reale Geschäfte, Restaurants, Cafés oder dergleichen in meine Bücher einzubauen. Zum einen können diese ja irgendwann schließen, zum anderen ist mir die Rechtslage dazu nicht ganz klar.
Wenn du nicht die Möglichkeit hast, ein Land zu besuchen oder die Kultur nicht kennst, über die du schreiben willst, so ist es vielleicht besser, die Finger davon zu lassen. Im Zweifelsfall kann auch ein Sensitivity Reading sinnvoll sein.
Doch selbst wenn du dich gänzlich gegen reale Orte entscheidest, bist du nicht aus dem Schneider.
Zu jedem Buch gehört ein gewisses Worldbuilding, selbst zum Liebesroman. Auch wenn du nur eine schnuckelige Kleinstadt in Schweden erfindest oder dir eine Kunstakademie in Prag ausdenkst, so musst du doch immer darauf achten, dass das ganze stimmig ist und Sinn ergibt, zumindest bis zu einem gewissen Grad.
Es wäre doch ziemlich peinlich, wenn du dir ein 100-Seelen-Dorf im dichten, isländischen Wald ausdenkst und dann bei der ersten Lesung darauf aufmerksam gemacht wirst, dass es in Island kaum Wald gibt.
3. Aus welcher Perspektive wird erzählt?
Die Erzählperspektive: Wir kennen sie alle noch aus der Schule und auch für unseren eigenen Roman ist sie überaus bedeutend.
Obwohl es noch mehr Erzählperspektiven gibt, möchte ich mich hier auf die Ich-Erzählerin und die personale Erzählerin beschränken, da ich nur mit diesen experimentiert habe.
Ich-Erzählerin
Du verschmilzt beim Schreiben mit deiner Protagonistin. Du siehst, was sie sieht. Du weißt, was sie weiß und du fühlst, was sie fühlt.
Frage dich immer: Kann sie das in diesem Augenblick überhaupt sehen oder wissen?
Diese Perspektive eignet sich besonders gut, wenn du tiefe Einblicke in die Gefühle eine Figur geben willst.
Beispiel: „Als ich aufwache, ist die andere Seite des Bettes kalt.“ ~ Die Tribute von Panem von Suzanne Collins.

Personale Erzählerin (Er/Sie-Erzählerin)
Ähnlich wie bei der Ich-Erzählerin erlebst du hier als Autorin alles, was auch deine Protagonistin erlebt. Mit dem Unterschied, dass du nicht gänzlich mit ihr verschmilzt, sondern ihr eher folgst wie ein Schatten.
Auch hier ist das Wissen deiner Figur limitiert und du musst dich stets fragen: Kann sie das in diesem Moment wirklich sehen, fühlen, wissen?
Besonders gut eignet sich diese Perspektive für Geschichten, die aus der Sicht mehrerer Figuren erzählt werden. Da anstatt „Ich“ immer der Name der Protagonistin oder das Pronomen genannt wird, fällt es den Leserinnen leichter, der Handlung zu folgen.
Beispiel: „Wenn Reva es sich recht überlegte, war es für ihre Tochter das Beste gewesen, dass sie sie im Stich gelassen hatte.“ ~ Tales of Toria 1 von mir.
Die wichtigste Regel ist, niemals innerhalb einer Szene die Perspektive zu wechseln. Besonders bei Anfängerinnen kann es dabei immer wieder zu Perspektivfehlern kommen, weil wir als Autorinnen ja einen Überblick über die gesamte Geschichte haben. Auch ich erwische mich regelmäßig dabei, wie ich meine Figuren etwas denken lasse, das diese zu diesem Zeitpunkt gar nicht wissen können.
Deshalb ist ein professionelles Lektorat unerlässlich!
Wenn du dich nicht entscheiden kannst, welche Perspektive du letztendlich wählen sollst, empfehle ich dir, deine Lieblingsbücher hervorzukramen und nachzuschauen, wie dort das Perspektiv-Problem gelöst wurde.
4. Wie viele POVs wird es geben?
POV ist die Abkürzung für den englischen Ausdruck „point of view“, der so viel bedeutet wie Erzählperspektive. Aus welcher Perspektive du schreiben willst, hast du ja bereits entschieden. Vielleicht hast du sogar einige deiner Lieblingsbücher durchgeblättert und nachgeschaut, aus welchen Perspektiven diese verfasst wurden. Hast du auch gezählt, wie viele Perspektivfiguren es gibt?
Die Einschränkungen der Ich-Perspektive und der personalen Perspektive können wir als Autorinnen auch zu unserem Vorteil nutzen, nämlich um Spannung aufzubauen. Da wir uns in einer Szene immer nur im Kopf einer einzigen Figur befinden, ist unsere Sicht auf die Geschehnisse im Roman eingeschränkt. Das heißt, wir können unseren Leserinnen ganz bewusst Wissen vorenthalten, indem wir ihnen bestimmte Szenen nur aus der Sicht von Figuren zeigen, die selbst noch nicht ganz begreifen, was eigentlich gerade vor sich geht.
Mein Fantasyroman „Tales of Toria 1 – Der König der Sternenstadt“ startet zum Beispiel aus der Sicht der Sternengöttin Reva, die eine folgenschwere Entscheidung trifft. Reva weiß in diesem Moment schon, während die Leserin noch im Dunkeln tappt. Im besten Fall möchte die Leserin nun erfahren, welche Auswirkungen die Entscheidung der Sternengöttin hat. Nach dieser Szene am Anfang wechsle ich direkt zu meinem Protagonisten Logan, der selbst noch nicht ahnt, was in den nächsten Wochen auf ihn zukommt. Er entdeckt die Sternenstadt Toria und nimmt dabei meine Leserin mit. Und irgendwann treffen beide – Logan und die Leserin – wieder auf die Sternengöttin.
Du siehst also, wie einfach es durch eine geschickte Auswahl an Perspektivfiguren ist, Geheimnisse zu bewahren und so die Spannung aufrechtzuerhalten.
5. Welchem Genre soll mein Roman zugeordnet werden?
Auch das Thema Genre war eines, mit dem ich mir lange Zeit sehr schwer getan habe und damit bin ich vermutlich nicht die Einzige. Vor allem am Anfang eines Manuskriptes, wenn das Ende noch ungewiss ist, kann es schwer sein, sich auf ein Genre festzulegen. Doch das Genre gibt nicht nur vor, wo dein Buch in der Buchhandlung stehen wird oder unter welcher Kategorie es in Onlineshops erhältlich sein wird, sondern in gewisser Weise auch die Handlung und die Sprache.
Wenn du nicht nur für dich schreiben möchtest, ist es essentiell, sich an Genrevorgaben zu halten, um deine zukünftige Leserin nicht zu enttäuschen. Standalone-Liebesromane sollten zum Beispiel immer ein Happy End haben. Wenn es keines gibt, wird sich dein Buch nur schwer als Liebesroman vermarkten lassen. Epische Fantasybücher brauchen ein durchdachtes Worldbuilding jenseits unserer Alltagsrealität, meistens angesiedelt in einer mittelalterlich anmutenden Welt.
Überlege dir also spätestens nach der Rohfassung, welchem Genre dein Roman angehören soll. Zu viele Sorgen musst du dir dabei allerdings gar nicht machen. Es gibt zwar nur eine Handvoll Genres, jedoch eine ganze Myriade von Subgenres. Mit Sicherheit wirst du in diesem Genre-Dschungel einen Stempel finden, den du deinem Buch aufdrücken kannst.